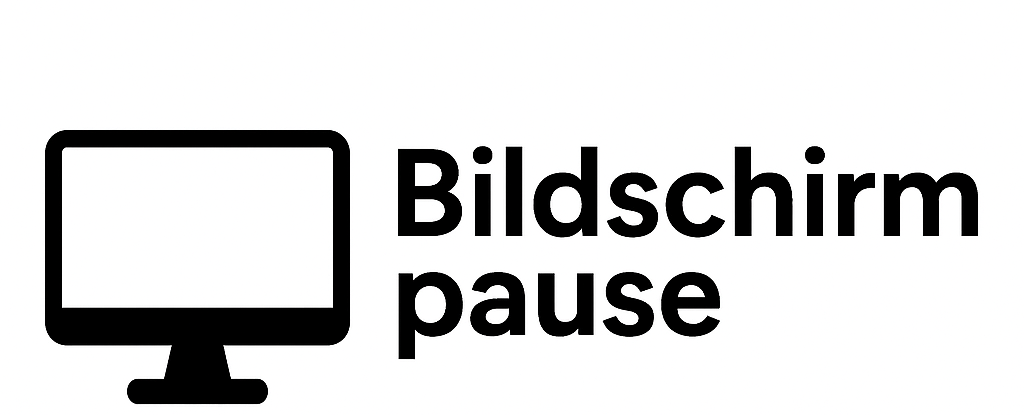Nie zuvor war der Bildschirm so nah, so bunt, so allgegenwärtig. Ob Tablet in der Schule, Handy in der Hosentasche oder Netflix am Abend – digitale Medien gehören längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Doch während Technik vieles einfacher, spannender und vernetzter macht, stellen Forschende immer häufiger eine Frage: Wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich gesund – und wann wird sie zur Belastung?
Mehr Zeit online – weniger echte Pausen
Studien zeigen deutlich: Kinder und Jugendliche verbringen heute so viel Zeit vor Bildschirmen wie nie zuvor. Laut einer Untersuchung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest liegt die durchschnittliche tägliche Bildschirmzeit bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren inzwischen bei über vier Stunden – zusätzlich zur schulischen Nutzung.
Dabei geht es längst nicht nur um Unterhaltung. Digitale Geräte sind Lernhilfe, Kommunikationsmittel und Freizeitbeschäftigung zugleich. Doch genau das macht es so schwierig, Grenzen zu ziehen. Das Gehirn bleibt ständig aktiv, Reize prasseln ununterbrochen ein – und echte Pausen werden seltener.
Was zu viel Bildschirmzeit mit Körper und Geist macht
Die Wissenschaft ist sich einig: Es kommt nicht nur auf die Dauer an, sondern auch auf die Art der Nutzung. Stundenlanges Scrollen durch soziale Medien wirkt anders als ein Online-Lernprogramm oder ein Videoanruf mit Freund:innen.
Trotzdem zeigen zahlreiche Studien bedenkliche Tendenzen:
- Schlafprobleme: Blaulicht von Bildschirmen stört die Melatoninproduktion – Kinder, die abends viel am Handy sind, schlafen schlechter und kürzer.
- Konzentrationsprobleme: Häufiger Medienwechsel (z. B. zwischen Apps, Chats und Videos) schwächt die Aufmerksamkeitsspanne.
- Psychische Belastungen: Untersuchungen, u. a. der Universität Calgary (2023), weisen auf einen Zusammenhang zwischen exzessiver Social-Media-Nutzung und erhöhtem Risiko für depressive Symptome bei Jugendlichen hin.
- Bewegungsmangel: Wer viel sitzt, bewegt sich weniger – mit Folgen für Haltung, Gewicht und körperliche Fitness.
Das bedeutet nicht, dass Bildschirme „schlecht“ sind – aber dauerhafte Reizüberflutung ohne Ausgleich kann langfristig stressen und überfordern.

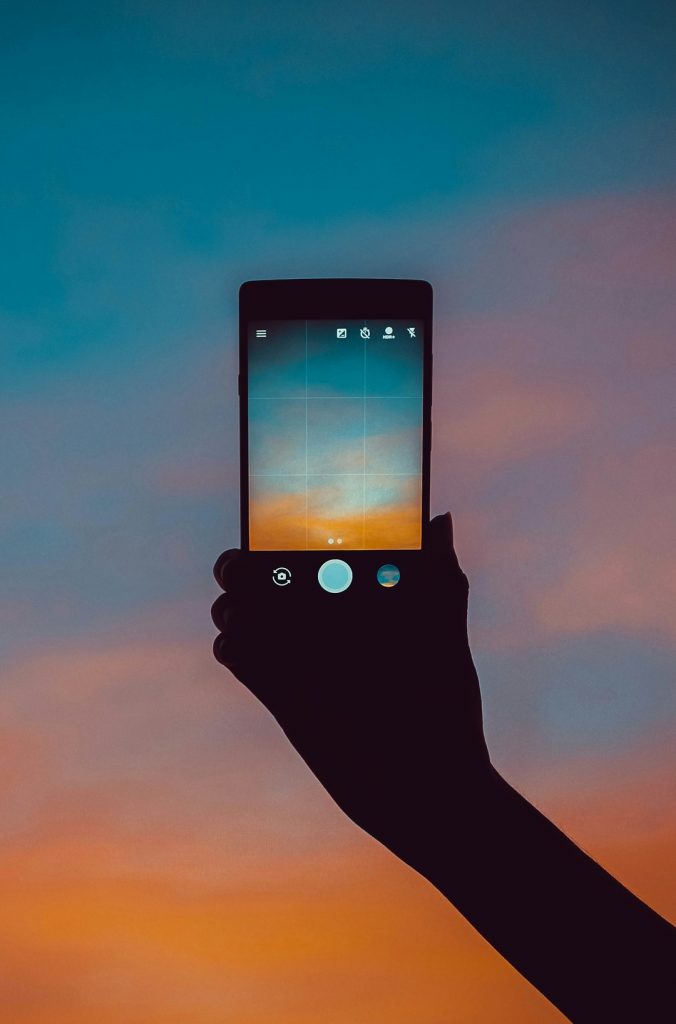
Die positiven Seiten nicht vergessen
Wissenschaftler:innen betonen gleichzeitig: Digitale Medien bieten auch Chancen.
Kinder und Jugendliche können kreativ werden, Wissen vertiefen, Freundschaften pflegen oder sogar Empathie entwickeln – wenn sie digitale Angebote sinnvoll nutzen. Entscheidend ist also die Balance zwischen Aktivität und Passivität.
Aktives Gestalten (z. B. Programmieren, Musik machen, Filme schneiden) wirkt ganz anders auf das Gehirn als passives Konsumieren (z. B. stundenlanges Scrollen oder Zappen).
Was Fachleute empfehlen
Die Empfehlungen variieren, aber sie haben eines gemeinsam: Bewusster Umgang statt starrer Verbote.
Die American Academy of Pediatrics rät Eltern, für jedes Kind individuelle Bildschirmzeiten festzulegen – abhängig von Alter, Reife und Nutzungskontext. Für jüngere Kinder sollte die Bildschirmzeit begrenzt sein, und vor allem: nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen.
Auch deutsche Fachgesellschaften betonen, wie wichtig gemeinsame Regeln und begleitete Nutzung sind. Kinder profitieren, wenn Erwachsene mit ihnen über Inhalte sprechen, Alternativen fördern und Vorbilder im eigenen Umgang mit Technik sind.
Fazit: Achtsamkeit statt Angst
Die Wissenschaft zeigt deutlich, dass Bildschirmzeit kein Feind, aber auch kein harmloser Begleiter ist. Sie kann lehren, verbinden, inspirieren – oder überfordern, abhängig davon, wie und wie lange sie genutzt wird.
Für Kinder und Jugendliche heißt das: nicht „offline statt online“, sondern bewusst, kreativ und mit Pausen leben. Wer regelmäßig Abstand nimmt, kann die Vorteile der digitalen Welt genießen, ohne sich darin zu verlieren.
Am Ende zählt also nicht nur die Zeit, sondern die Qualität der Momente – on- und offline.